Sauerteig ansetzen ist kein Hexenwerk! Mit Mehl, Wasser, Wärme und Geduld erweckst du deine eigene kleine Hefefarm zum Leben. 😃 Wenn du die nachfolgenden Tipps beherzigst und dich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen lässt, wirst du bald mit köstlichem selbstgebackenem Sauerteigbrot belohnt. Wir hoffen, dir alle wichtigen Fragen zu erklären und dich zu motivieren, es selbst auszuprobieren.
Was ist Sauerteig?
Sauerteig ist ein natürlicher Teigstarter aus Mehl und Wasser, in dem sich wilde Hefen und Milchsäurebakterien ansiedeln und vermehren. Durch Fermentation verstoffwechseln diese Mikroorganismen die Mehlstärke und bilden dabei Kohlendioxid und organische Säuren. Das Kohlendioxid lockert den Brotteig auf (ähnlich wie gekaufte Hefe) und lässt ihn aufgehen, während die Säuren für den typischen säuerlichen Geschmack sorgen und den Teig haltbarer machen. Sauerteig dient also, genauso wie Hefe, als Triebmittel beim Backen, verleiht dem Brot aber einen einzigartigen Geschmack und eine längere Frischhaltung.
Das Gemisch aus Mehl, Wasser und den lebenden Kulturen bezeichnet man auch als Sauerteigansatz oder Anstellgut. Dieses Anstellgut wird zum „Impfen“ neuer Teige verwendet: Ein Teil des reifen Sauerteigs kommt in den Brotteig, um ihn zu lockern, während der Rest des Sauerteigs aufgehoben und weitergefüttert wird. Auf diese Weise kann ein einmal hergestellter Sauerteig theoretisch ewig weiterleben, manche Bäcker hüten jahrzehntealte Sauerteigkulturen wie einen Schatz.
Sauerteig ansetzen – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Jetzt wird’s praktisch: Hier erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du einen Sauerteigstarter (in diesem Beispiel mit Roggenmehl) von Grund auf ansetzen kannst. Halte Mehl, Wasser, ein großes, sauberes Glas und etwas Zeit bereit – und schon kannst du loslegen! Tipp: Nutze unser Sauerteig Starter Glas Set, damit wird das Sauerteig ansetzen zum absoluten Kinderspiel!
Diese Zutaten & Ausstattung brauchst du zum Ansetzen eines eigenen Sauerteigs:
-
Mehl: Am gebräuchlichsten ist Roggenmehl (Type 1150 oder Roggen-Vollkorn) für den Start. Du kannst aber auch Weizen- oder Dinkelmehl verwenden (möglichst höherer Ausmahlungsgrad bzw. Vollkorn). In dieser Anleitung nehmen wir z.B. Roggen-Vollkornmehl.
-
Wasser: Normales Leitungswasser, lauwarm (handwarm ~30°C). Verwende möglichst stilles Wasser ohne Chlorgeruch – falls dein Leitungswasser stark gechlort ist, lass es vorher einige Stunden stehen oder nimm gefiltertes Wasser, damit die Mikroorganismen nicht gehemmt werden.
-
Gefäß: Entweder du nimmst unser Brotliebling Sauerteig Starter Glas oder ein anderes sauberes Glas mit Deckel. Der Deckel sollte nicht luftdicht abschließen – ideal ist ein Bügelglas ohne Gummiring, ein Schraubglas mit lose aufgelegtem Deckel oder du deckst das Glas mit einem sauberen Tuch/Frischhaltefolie ab und machst ein Gummiband darum. Wichtig: Das Gefäß nicht randvoll machen, sondern nur höchstens halb füllen, damit der Teig Platz zum Aufgehen hat.
-
Passender Ort: Ein warmer Platz (~25–30°C) für den Teig. Das kann z.B. in der Nähe einer Heizung sein, im leicht angewärmten Backofen (z.B. Ofen kurz auf 30°C bringen und ausschalten, oder nur mit eingeschalteter Ofenlampe als Wärmequelle), oder einfach in der warmen Küche im Sommer. Konstante Wärme beschleunigt die Gärung.
Und so gehts: So setzt du einen Sauerteig Starter an:
-
Tag 1: Vermische 50 g Roggenmehl mit 50 ml lauwarmem Wasser in einem sauberen Glas, bis ein zähflüssiger Teigbrei entsteht. Kratze Mehlreste vom Rand, sodass alles gut vermischt ist. Decke das Glas locker ab (Deckel nur auflegen, nicht zuschrauben) und stelle es an einen warmen Ort bei ca. 25–30 °C. Jetzt passiert erst mal 24 Stunden nichts – der Teig darf in Ruhe beginnen zu fermentieren. (Tipp: Falls der Brei extrem fest ist, kannst du ein klein wenig mehr Wasser hinzufügen. Die Konsistenz sollte wie ein dicker Pfannkuchenteig sein.)
-
Tag 2: Schau nach, ob sich erste Bläschen zeigen – eventuell riecht es schon leicht. Gib nun erneut 50 g Mehl und 50 ml lauwarmes Wasser zum Ansatz dazu. Rühre wieder gründlich um, bis keine Klümpchen bleiben. Decke das Gefäß wieder locker ab und lass den Teig erneut 24 Stunden warm stehen. (Noch tut sich meist nicht viel Sichtbares, aber im Verborgenen arbeiten die ersten Bakterien bereits. Wenn es etwas streng riecht, ist das normal – dazu gleich mehr.)
-
Tag 3: Öffne das Glas. Idealerweise sind jetzt schon einige Bläschen an der Oberfläche oder im Teig sichtbar. Rieche am Ansatz: ein säuerlicher Geruch (ähnlich Essig oder Joghurt) ist perfekt. Manchmal riecht der Teig an Tag 3 auch etwas unangenehm oder „hängig“ (leicht faulig) – lass dich davon nicht abschrecken, das kann normal sein. Wichtig ist, dass kein Schimmel sichtbar ist. Falls sich doch Schimmel (bunte oder pelzige Punkte) gebildet haben sollte, brich lieber ab und starte neu, um kein Risiko einzugehen.
Füttern: Wenn kein Schimmel da ist, füttere den Sauerteig wie gehabt: Wieder 50 g Mehl + 50 ml warmes Wasser einrühren. Abdecken und warm stellen für weitere 24 Stunden.
-
Tag 4: Dein Sauerteig sollte inzwischen deutlich an Volumen zugelegt haben (er geht merklich „auf“) und ist von vielen feinen Bläschen durchzogen. Der Geruch ist säuerlich-angenehm (vielleicht erinnert er an Joghurt, Hefe oder Bier). Glückwunsch: Wenn das der Fall ist, ist dein eigener Sauerteig jetzt fertig und bereit zum Backen!🎉
Falls der Teig am Tag 4 noch nicht richtig aufgegangen ist oder noch sehr streng riecht, gib ihm einfach noch mehr Zeit: Wiederhole das Füttern wie an Tag 3 (50 g Mehl + 50 ml Wasser) und lass ihn nochmals 12–24 h warm stehen. Jeder Ansatz entwickelt sich individuell – manche brauchen einen Tag länger. Spätestens nach 5 Tagen sollte er aber soweit sein, dass genug Triebkraft und Säure entstanden sind.
- Tag 5+(optional): Spätestens jetzt ist dein Sauerteigstarter einsatzbereit. Er hat nun den Status „Anstellgut“ – so bezeichnet man einen fertigen Sauerteig, den man zum Backen verwendet und durch Füttern am Leben erhält. Du kannst nun entweder direkt dein erstes Sauerteigbrot backen oder den Sauerteig zunächst für später aufbewahren. Übrig gebliebenen Starter bewahrst du im Kühlschrank auf oder nutzt Reste in anderen Rezepten. Vergiss nicht, dem Sauerteig einen Namen zu geben, wenn du magst 😉 – viele Hobbybäcker taufen ihren Sauerteig (Spaß muss sein).
Wichtig: Wenn es nicht gleich das erste mal klappt, gib nicht auf! Auch wir haben beim ersten Mal zwei Versuche gebraucht, bis der Sauerteig Ansatz geklappt hat.
Wenn du deinen Sauerteig angesetzt hast musst du ihn pflegen und regelmäßig füttern, damit er am Leben bleibt!
Woran erkennt man einen "reifen" Sauerteig Ansatz?
Reifer Sauerteig ist voluminös und blasig: Er bildet Bläschen, vergrößert sich nach dem Füttern etwa auf das Doppelte und fällt nach Erreichen seines Höhepunkts wieder etwas in sich zusammen. Der Geruch ist angenehm säuerlich (nicht mehr stechend oder faulig). Im Vergleich zu jungen Ansätzen geht ein reifer Sauerteigstarter nach dem Füttern viel schneller auf – oft verdoppelt er sein Volumen bereits in 4–8 Stunden. Spätestens wenn der Teig diese Triebkraft zeigt, kannst du ihn bedenkenlos fürs Backen einsetzen. (Ein Trick unter Bäckern ist der Schwimmtest: Ein Löffel reifer Sauerteig schwimmt in Wasser obenauf. Das deutet darauf hin, dass genügend Gärgase im Teig gebunden sind. Dieser Test ist aber nicht immer zuverlässig – verlasse dich ruhig auf Auge, Nase und Erfahrung.)
Mehlarten beim Sauerteig ansetzen: Roggen, Weizen, Dinkel
Welches Mehl eignet sich am besten, um Sauerteig anzusetzen? Grundsätzlich kannst du jeden Getreidetyp verwenden – die gängigsten sind Roggen, Weizen und Dinkel. Es gibt jedoch ein paar Unterschiede in Verhalten und Ergebnis je nach Mehlsorte:
-
Roggenmehl: Roggensauerteig ist der Klassiker und für Einsteiger sehr zu empfehlen. Roggen bietet von Natur aus ideale Bedingungen für die Sauerteig-Mikroben: Durch seinen hohen Anteil an Schleimstoffen (Pentosanen) liefert Roggenmehl viel „Futter“ und Feuchtigkeit, was die Vermehrung von Milchsäurebakterien und Hefen begünstigt. Ein Roggensauerteig entwickelt sich daher meist sehr schnell und stabil – oft hat er schon nach wenigen Tagen genug Triebkraft, um als alleiniges Backtriebmittel zu dienen. Roggenmehl enthält zudem Enzyme, die im Sauerteigprozess Stärke abbauen. Ohne Säuerung würde Roggenteig durch diese Enzyme klebrig und das Brot würde flach und kompakt bleiben – der Sauerteig macht Roggenmehl überhaupt erst backfähig. Geschmacklich bringt Roggensauerteig ein kräftig würzig-saures Aroma, typisch für traditionelle deutsche Brotarten. Roggenbrot oder Roggenmischbrot erhält dadurch seinen charakteristischen Geschmack. Tipp: Mit Roggensauerteig kannst du tatsächlich auch Brote mit anderen Mehlen backen – z.B. Weizen- oder Dinkelbrote lassen sich problemlos mit einem Roggen-Anstellgut starten. In vielen Fällen schmeckt man kaum einen Unterschied in der Krume, insbesondere wenn kein direkter Vergleich da ist. Daher nutzen viele Hobbybäcker einen Roggensauer als „Universalsauerteig“, den sie je nach Rezept auch für Weizen- oder Dinkelteige einsetzen.
-
Weizenmehl: Weizensauerteig (in Frankreich auch Levain, in Italien als lievito madre – sofern fest – bekannt) ist ebenfalls möglich, braucht aber mit hellem Weizenmehl manchmal etwas länger, um in Schwung zu kommen. Ist er einmal etabliert, ist er aber genauso robust und pflegeleicht. Weizensauer ist in der Regel milder in der Säure als Roggensauer – das macht ihn beliebt für hellere Brote, Baguette, Ciabatta oder Brötchen, wo man ein dezenteres Aroma möchte. Durch den höheren Glutenanteil im Weizen sorgt ein Weizensauerteig außerdem für sehr luftige, lockere Teige und kann bei langer Fermentation feine Aromenspuren von milchig-mild bis leicht fruchtig-nussig hervorbringen. Typische Einsatzgebiete für Weizensauerteig sind französische Landbrote, helle Mischbrote und generell Brote mit hohem Weizenanteil. Auch für Süßgebäck eignet sich ein milder Weizensauer (Stichwort Panettone oder Brioche mit Lievito Madre). Beachte: Für reine Roggenbrote ist ein reiner Weizensauer zwar theoretisch verwendbar (der Teig würde schon sauer, wenn man ihn umzüchtet), aber man erzielt damit nicht das typische Roggenaroma. Umgekehrt kann man aber aus einem Weizen-Anstellgut durch ein paar Fütterungen mit Roggenmehl durchaus einen funktionsfähigen Roggensauer ziehen.
-
Dinkelmehl: Dinkelsauerteig verhält sich ähnlich wie Weizensauerteig, da Dinkel biologisch eng mit Weizen verwandt ist. Viele sparen sich daher einen separaten Dinkelsauer, weil man aus einem Roggen- oder Weizensauer auch einen Dinkelsauer machen kann, indem man ihn ein paar Mal mit Dinkel füttert. Dinkelsauerteig liefert ein mildes, fein-aromatisches Profil und wird gerne für Dinkelbrote oder -brötchen verwendet, da er die Bekömmlichkeit verbessert (Dinkel enthält weniger Gluten, wird aber durch Sauerteig noch verträglicher). Kurzum: Hast du einen aktiven Sauerteig (egal ob Roggen oder Weizen), kannst du ihn jederzeit auf eine andere Mehlart umstellen, indem du bei den nächsten Fütterungen das neue Mehl verwendest. Es ist also nicht nötig, mehrere Anstellgute dauerhaft parallel zu pflegen, außer du möchtest immer sortenreinen Geschmack. Als Anfänger startest du am besten mit Roggen (Vollkorn) – damit hast du schnelle Erfolgserlebnisse und einen universell einsetzbaren Starter. Später kannst du immer noch experimentieren.
Mehl-Type und Vollkorn: Grundsätzlich gilt: Fürs Ansetzen eines Sauerteigs ist Vollkornmehl oder Mehl mit hoher Type von Vorteil. In den Randschichten des Korns (Kleie, Schale), die im Vollkornmehl enthalten sind, befinden sich besonders viele wilde Hefen und Bakterien. Außerdem liefern die Schalenteile mehr Mineralstoffe, was den Mikroorganismen als Nahrung dient. Mit hellem Auszugsmehl (z.B. Typ 405) kann ein Starter zwar auch gelingen, dauert aber oft länger und ist anfälliger für Fehlgärungen (weil Nährstoffe fehlen). Du kannst z.B. auch mischen: Manche Bäcker setzen Weizensauerteig mit 90% Mehl Type 550 und 10% Vollkornanteil an, um eine extra Portion Nährstoffe einzubringen. Für den Start ist jedoch 100% Vollkorn (oder zumindest Type 1150/1050) eine sichere Bank.
Häufige Anfängerfehler beim Sauerteig ansetzen(und wie man sie vermeidet)
Auch wenn Sauerteig ansetzen einfach ist, schleichen sich bei Neulingen gerne ein paar Fehler ein. Hier einige typische Probleme und wie du sie vermeidest:
-
Mein Sauerteig blubbert nicht.“ – Häufigste Ursache: zu kalt geführt. Stelle den Ansatz an einen wärmeren Ort (ideal 22–26 °C). Alternativ falsches Mehl: Vollkorn liefert mehr Nährstoffe als nur weißes Mehl. Oder du hast ihn zu wenig gefüttert – gib ihm regelmäßig Nachschub. Geduld haben: In den ersten 1–2 Tagen tut sich oft noch nichts Sichtbares.
-
„Mein Sauerteig riecht komisch/unangenehm.“ – Ein leicht säuerlicher Geruch (nach Joghurt, Essig) ist normal. Riecht er allerdings modrig oder faulig, kann das auf Fehlgärungen hindeuten. Hier hilft Sauberkeit (sterile Gefäße verwenden, keine Fremdkontamination) und regelmäßiges Füttern, damit gute Kulturen überhand behalten. Wichtig: Bei sichtbarem Schimmel (farbige Flecken, Pelz) -> wegwerfen! Ein junges Anstellgut kann in den ersten Tagen auch mal streng riechen (man spricht manchmal von „Babypups“😉) – solange kein Schimmel da ist, füttern und weitermachen, der Geruch pendelt sich ein.
-
„Der Deckel ist mir um die Ohren geflogen!“ – Oha, dann war das Gefäß wohl zu dicht verschlossen. Sauerteig erzeugt Kohlensäure-Gas, das irgendwo hin muss. Immer luftdurchlässig oder nur lose abdecken, nie fest zuschrauben, sonst baut sich Druck auf. Und fülle das Glas nur halb, damit Platz ist – ein sehr aktiver Sauerteig kann sonst übersprudeln (mir schon passiert – Riesensauerei im Küchenschrank).
-
„Mein Sauerteigstarter ist verschimmelt.“ – Das kann passieren, wenn Fremdsporen reinkommen oder der Teig zu lange ohne Fütterung steht und verdirbt. Vorbeugen: Sauber arbeiten (Glas und Löffel sauber, keine Essensreste in der Nähe), den Teig nicht austrocknen lassen (abdecken) und bei Auffälligkeiten (rot-orange Verfärbung, Pelz) sofort entsorgen. Sicherheit geht vor – leider hilft da nur neu anfangen. Zur Beruhigung: Mit sauberer Methode passiert Schimmel eher selten.
-
„Mein Brot ging nicht richtig auf.“ – Wenn das erste Sauerteigbrot platt und kompakt bleibt, liegt es oft daran, dass der Sauerteigstarter noch unreif war. Ein junger Starter (unter 5-7 Tage alt) hat oft noch zu wenig Triebkraft – nimm anfangs besser einen Teil Hefe zur Unterstützung oder warte ein paar Tage länger. Auch wichtig: Gehzeit einhalten. Sauerteig braucht oft länger als Hefeteig, manchmal 4–6 Stunden oder mehr, bis das Brot ausreichend aufgegangen ist. Plane also genug Zeit fürs Reifen des Teigs ein. Auch zu wenig Wasser im Brotteig (ein sehr fester Teig) führt zu geringerem Ofentrieb – halte dich ans Rezept und achte auf weiche, elastische Teigkonsistenz.
-
„Mein Brot schmeckt zu sauer.“ – Falls dir dein Sauerteigbrot zu sauer ist, kannst du gegensteuern: Führe den Sauerteig wärmer und kürzer (mehr Milchsäure, weniger Essigsäure). Verkürze ggf. die Sauerteig-Reifezeit oder verwende etwas weniger Sauerteig im Hauptteig. Ein häufiger Grund für sehr saures Brot ist auch Überreife – wenn der Sauerteig zu lange stand und schon „drüber“ war. Verwende ihn im optimalen Zustand (wenn er am höchsten Punkt ist, nicht erst wenn er schon eingefallen und super sauer ist). Ein gut gefütterter, aktiver Sauerteig schmeckt milder als ein ausgehungerter.
-
„Mein Brot ist innen klitschig/teigig.“ – Dann war entweder die Backzeit zu kurz (Brot nicht durchgebacken) oder – wahrscheinlicher bei Sauerteig – der Teig war nicht richtig durchgesäuert. Bei reinen Roggenbroten z.B. führt ein zu kurz geführter Sauerteig dazu, dass das Brot „klitschig“ bleibt, weil noch zu viel Stärke abgebaut wird. Lösung: Beim nächsten Mal den Sauerteig länger reifen lassen, auf genügend Säure achten (pH muss niedrig genug sein) oder einen Teil des Mehls im Brot durchgesäuertes Mehl (Sauerteig) ersetzen. Anfänger nehmen bei Roggenbroten lieber ein Rezept mit etwas Hefe zusätzlich, bis man das Handling raus hat.
-
„Mein Sauerteig bildet oben eine braune Flüssigkeit.“ – Keine Sorge, das ist Alkohol/Wasser (man nennt es Hooch oder Führwasser) und passiert, wenn der Teig lange gestanden hat und die Hefen nichts mehr zu futtern hatten. Einfach abgießen oder unterrühren und Sauerteig auffrischen. Das ist kein Fehler, sondern ein Zeichen, dass eine Fütterung fällig wäre.
-
„Kann ich meinen Sauerteig einfrieren?“ – Ja, kannst du. Am besten fütterst du ihn, lässt ihn kurz aktiv werden und legst dann eine kleine Portion (z.B. 50 g) in einem Schraubglas ins Gefrierfach. Nach dem Auftauen braucht er aber mehrere Auffrischungen, um wieder volle Power zu haben. Besser als Einfrieren ist wie gesagt das Trocknen, weil dabei praktisch alle Organismen überleben.
-
„Hilfe, mein Starter stinkt nach Nagellack/Alkohol.“ – Das kann passieren, wenn der Sauerteig sehr hungrig ist. Er bildet dann Ester und Alkohole, die chemisch riechen. Löse das Problem mit ein paar Auffrisch-Fütterungen hintereinander. In 1–2 Tagen riecht er wieder angenehm. Der Nagellack-Geruch ist nicht gefährlich, zeigt aber, dass der Teig zu lange stand oder zu wenig Nahrung hatte.
Falls mal etwas nicht klappt: Nicht entmutigen lassen! Jeder Fehler bringt dich beim Verständnis weiter. Bald wirst du ein Gefühl für „deinen“ Sauerteig entwickeln.
Willst du noch mehr Wissen über Sauerteig ansetzen, pflegen, füttern und backen?
|
Ultimative Brotliebling Sauerteig Guide:Alles was du zum Thema Sauerteig ansetzen, pflegen und Sauerteigbrot backen wissen musst auf über 100 Seiten mit anschaulichen Grafiken, Anleitungen sowie Spickzettel zum Ausdrucken. |
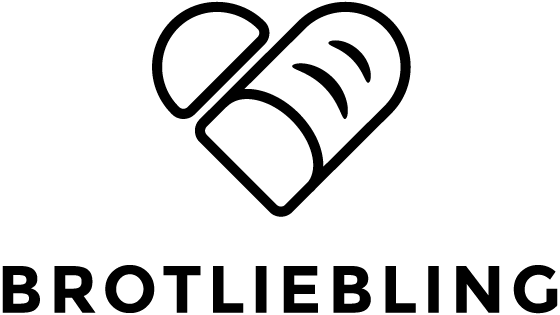


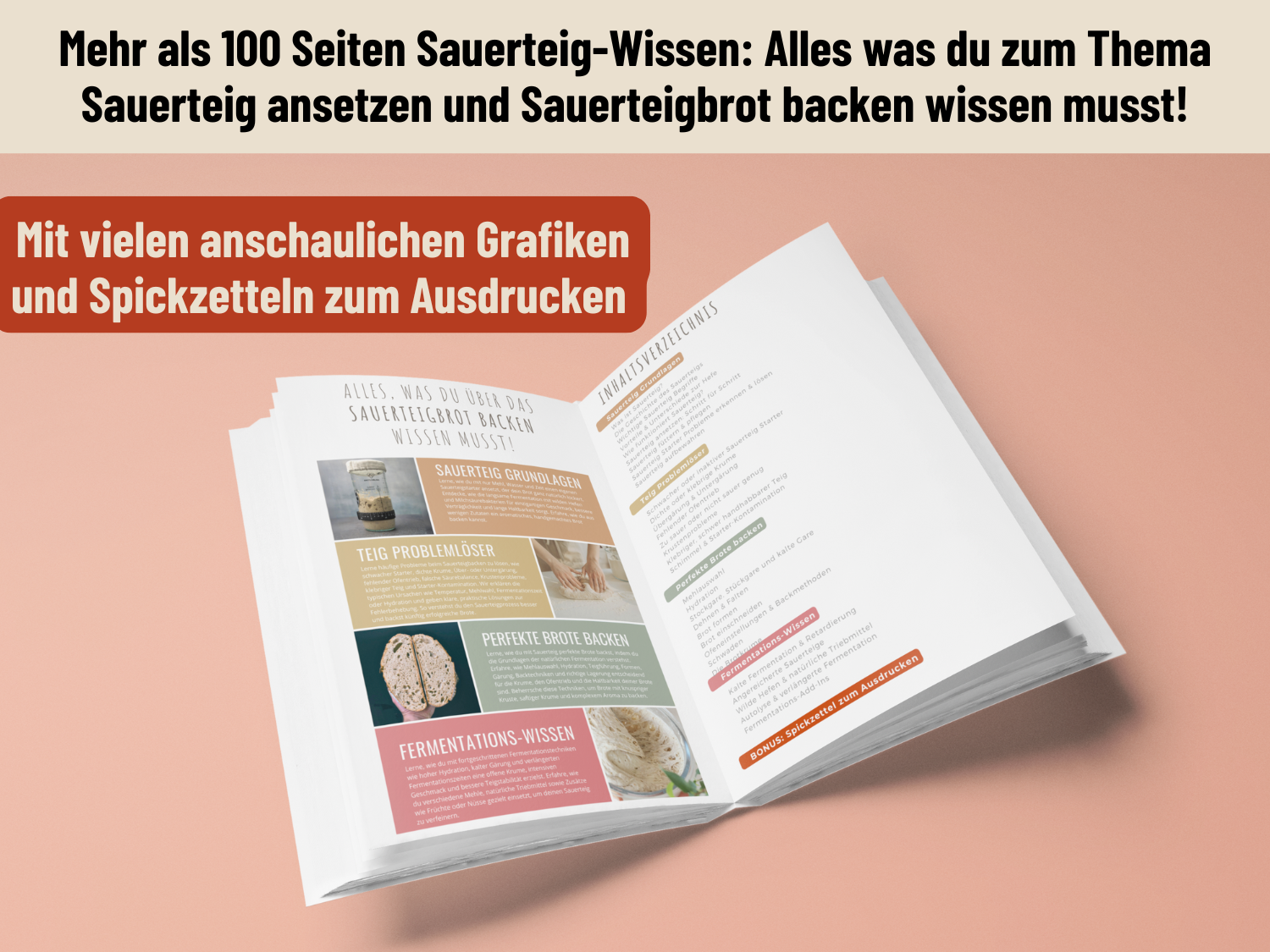
Super Anleitung, denke sehr verständlich für jeden. Ich starte morgen damit..
Tolle Anleitung und super Infos für den Start mit dem Sauerteig ansetzen. Ich habe mir gleich das Sauerteig Starter Set von euch bestellt und werde mich endlich trauen, einen eigenen Sauerteig anzusetzen. Vielen Dank
Klasse Anleitung! Vielen Dank, als Anfänger habe ich gerade viel gelernt!!! Bookmark ist dir natürlich sicher, während mein erster Bio-Roggenmehl (Namens Ruth!) Sauerteig im Wasserbett bei 26° reift und auf die erste Auffrischung nach 24 Stunden wartet!